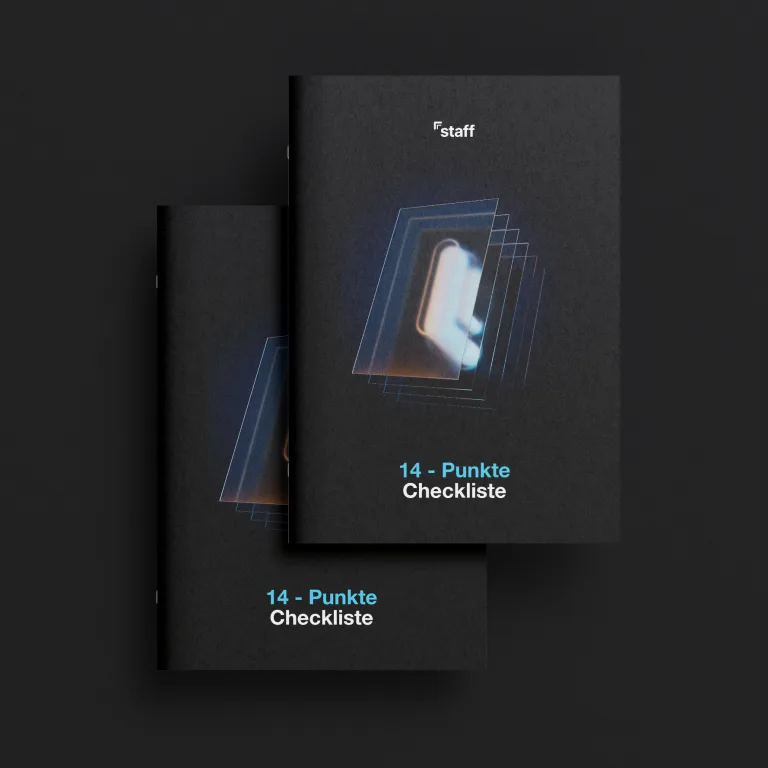Diese Frage lässt sich auf den ersten Blick einfach stellen – aber nur schwer seriös beantworten. Es gibt keinen einheitlichen „normalen“ Krankenstand, der sich verlässlich auf alle Unternehmen übertragen ließe.
Zahlen, die in öffentlichen Berichten oder über Krankenkassen veröffentlicht werden, spiegeln die Realität in den Betrieben nur bedingt wider. Einer der Hauptgründe: Nicht alle Fehlzeiten werden dort erfasst. Unternehmen, die eine Krankschreibung erst ab dem dritten oder vierten Tag verlangen, melden Kurzzeiterkrankungen oft gar nicht an die Krankenkasse. Dadurch entsteht eine Verzerrung in den Statistiken – und die offiziell veröffentlichten Werte unterschätzen die tatsächlichen Krankenstände.
Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus der Berechnungsbasis: Krankenkassen arbeiten meist mit 365 Kalendertagen, während Unternehmen in der Regel von 220 bis 250 Arbeitstagen ausgehen. Auch das erschwert den Vergleich deutlich.
Branchen- und Standortfaktoren
Darüber hinaus gibt es erhebliche branchen- und standortspezifische Unterschiede. Selbst Unternehmen derselben Branche weisen teils deutliche Abweichungen auf – abhängig von Faktoren wie:
Automatisierungsgradder Prozesse
Entlohnungsstruktur undSozialleistungen
Qualifikationsniveauder Mitarbeitenden
Gewerkschaftliche Organisation oder Tarifbindung
Regionale Arbeitsmarktlage und verfügbare Fachkräfte
Individuelle Bewertung mit erkennbaren Mustern
All diese Einflüsse machen eine einfache Benchmark-Aussage unmöglich. Tendenziell zeigt die Praxis jedoch klare Muster:
Krankenstand inadministrativen Bereichen
Grippe, Erkältungswellen oder PollenfIn Verwaltung, HR und Vertrieb liegt der Krankenstand meist bei 2,5 % bis 3 %. Werte darüber gelten als kritisch und sollten genauer analysiert werden.lug führen regelmäßig zu erhöhten Fehlzeiten in bestimmten Jahreszeiten.
Krankenstand inproduktiven Bereichen
In Fertigung, Montage und Logistik liegt der Krankenstand typischerweise bei 4 % bis 4,5 %. Höhere Werte deuten auf Optimierungspotenzial hin.
Die Ursachen für höhere Krankenstände in der Produktion liegen oft in der körperlichen Belastung, Schichtarbeit, geringerer Aufgabenvielfalt, auch der Führung und den Zeit- und Leistungsdruck, der mit der Ausbringung von Produktionszielen einhergeht, der durch hohe Krankenstände und den Einsatz von Leiharbeitern mit weniger Kenntnis und Routine verstärkt wird.
Letztlich gilt: Jeder Betrieb braucht seinen eigenen Maßstab, basierend auf Tätigkeitsstruktur, Mitarbeiterprofil und Organisationskultur. Nur dann lassen sich Krankenstände sinnvoll bewerten und gezielt verbessern.
Absentismus – wenn Fehlzeiten ein Muster werden
Der Begriff Absentismus bezeichnet das wiederholte oder häufige Fehlen von Mitarbeitenden, das nicht primär medizinisch erklärbar ist, sondern meist auf psychosoziale, organisatorische oder motivationale Ursachen zurückgeht.
Er beschreibt also kein einmaliges Krankheitsgeschehen, sondern ein Verhalten mit erkennbaren Mustern, das sich über die Zeit entwickelt.
Absentismus ist damit weniger ein medizinisches, sondern ein verhaltensbezogenes und strukturelles Phänomen. Er kann Ausdruck von Unzufriedenheit, Überforderung, Konflikten, fehlender Bindung oder mangelnder Wertschätzung sein – und in manchen Fällen auch eine Reaktion auf Mobbing oder anhaltend belastende Arbeitsbedingungen.
Typische Anzeichen sind:
Krankmeldungen an Montagen oder Freitagen
Das klassische „verlängerte Wochenende“.
Mehrtägige Krankmeldungen im Zusammenhang mit Konflikten
z. B. nach Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten oder Kollegen.
Häufungen von Abwesenheiten in arbeitsintensiven oder stressigen Projektphasen.
Fehlzeiten an Brückentagen, Geburtstagen oder nach Urlaubsphasen.
Wiederkehrende Kurzzeiterkrankungen ohne medizinisch nachvollziehbare Ursache.
Abwesenheiten bei ungeliebten Aufgaben, Schichtänderungen oder Versetzungen.
Auffällige Muster einzelner Abteilungen oder Teams
Muster die auf Belastung, Frustration oder fehlende Führungsklarheit hindeuten.
Hohe Schwankungen in der Krankheitsquote
im Vergleich zu ähnlichen Tätigkeiten oder Bereichen.
Absentismus verstehen und erkennen
Absentismus entsteht selten von heute auf morgen. Er ist meist das Ergebnis wiederkehrender Belastungen, eingeschränkter Kommunikation oder geringem Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Führung. Um ihn zu erkennen, braucht es daher nicht nur Zahlen, sondern auch ein Gespür für Teamdynamik, Stimmung und Unternehmenskultur.
Abgrenzung
Absentismus und Präsentismus stehen häufig im Mittelpunkt betrieblicher Gesundheitsdiskussionen. Beide Phänomene sind für Unternehmen problematisch – jedoch auf unterschiedliche Weise.
- Absentismus bedeutet: überdurchschnittliche Fehlzeiten ohne eindeutige medizinische Notwendigkeit.
- Präsentismus bedeutet: Mitarbeitende erscheinen zur Arbeit, obwohl sie gesundheitlich eingeschränkt oder krank sind.
Während der Absentismus direkte Kosten durch 100 % Lohnfortzahlung bei 0 % Leistung verursacht, ist der Präsentismus in seiner Wirkung differenzierter zu betrachten. Häufig wird behauptet, dass Präsentismus für Unternehmen noch teurer sei als Absentismus – das lässt sich jedoch nicht pauschal bestätigen.
Aus betrieblicher Sicht stellt sich die Situation in Deutschland meist anders dar:
Ein erkrankter Mitarbeitender, der trotz Einschränkungen arbeitet, erbringt zumindest eine teilweise Leistung – sei es 10 %, 30 % oder 50 %. Im Verhältnis bedeutet das: ein Teil Leistung gegen volles Gehalt, während beim Absentismus kein Leistungsbeitrag erfolgt. Somit ist der finanzielle Schaden durch Absentismus in vielen Fällen deutlich höher.
Natürlich birgt Präsentismus Risiken: Mitarbeitende können sich selbst überlasten oder Kolleginnen und Kollegen anstecken. Genau hier liegt eine klare Führungsaufgabe – die Fürsorgepflicht verlangt, dass Führungskräfte eingreifen und gesundheitlich eingeschränkte Mitarbeitende gegebenenfalls nach Hause schicken, um sie und das Team zu schützen.
Zudem gibt es flexible Lösungen, die Präsentismus entschärfen können:
- Homeoffice oder eingeschränkter Einsatz, wenn Tätigkeiten das zulassen.
- In manchen Ländern, etwa in Skandinavien, existiert eine Teilzeit-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – Mitarbeitende werden nicht vollständig krankgeschrieben, sondern können in angepasstem Umfang weiterarbeiten.
International betrachtet unterscheidet sich das Bild ebenfalls:
In Ländern ohne Lohnfortzahlung – etwa Teilen der USA – kann Präsentismus tatsächlich zu höheren Kosten führen, weil Mitarbeitende aus Existenzgründen krank zur Arbeit kommen, dort aber nur eingeschränkt leistungsfähig sind. In diesem Fall steht viel Geld für wenig Leistung gegenüber.
Absentismus und Präsentismus aktiv managen
Beide Phänomene sind ernst zu nehmen. Absentismus verursacht unmittelbare Kosten und Produktivitätsverluste, Präsentismus kann langfristig gesundheitliche Folgeschäden oder Teamprobleme hervorrufen. Entscheidend ist, dass Führungskräfte beide Themen aktiv managen – mit klaren Regeln, Kommunikation und Verantwortung.
Krankenstand berechnen & Auffälligkeiten analysieren
Der Gesamtkrankenstand allein liefert nur eine oberflächliche Momentaufnahme. Um Belastungszonen, Schwachstellen oder Führungsdefizite zu erkennen, müssen typische Muster – wie häufige Kurzzeiterkrankungen, wiederkehrende Ausfälle oder auffällige Abteilungswerte – analysiert werden. Digitale Mustererkennung ermöglicht, Auffälligkeiten sofort zu erkennen, statt zeitaufwendige Analysen durchzuführen. So wird der Krankenstand vom reinen Wert zum Steuerungsinstrument für gezieltes Handeln.