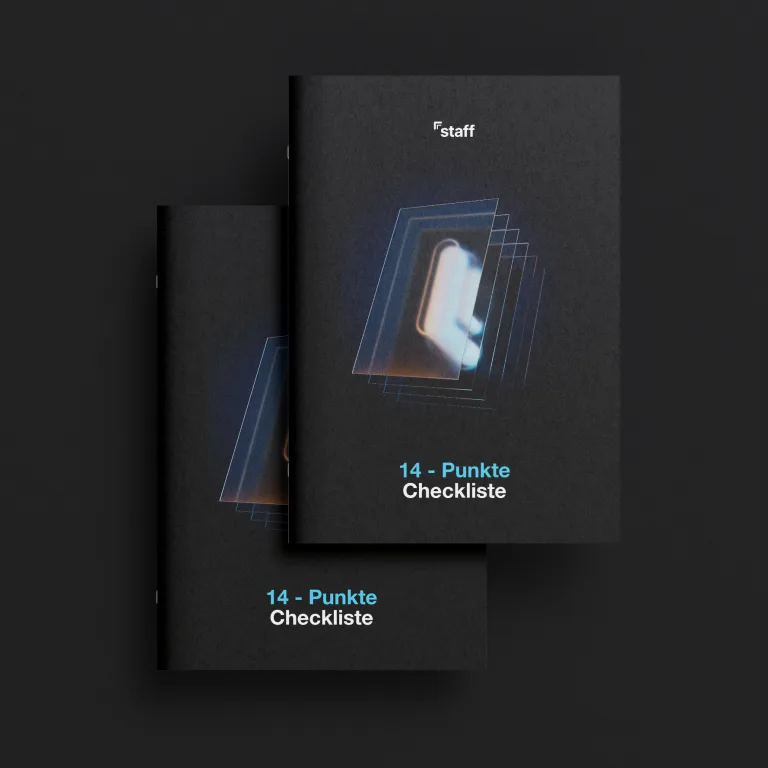Um einen hohen Krankenstand wirksam zu senken, braucht es zuerst eine klare Ursachenanalyse. Die Erfahrung zeigt: Selten gibt es nur einen Auslöser – meist wirken mehrere Faktoren gleichzeitig. Manche liegen innerhalb des Unternehmens, wie Arbeitsbedingungen oder Führungskultur. Andere kommen von außen, etwa saisonale Krankheitswellen oder demografische Entwicklungen. Und nicht zu vergessen: persönliche Gründe, die Mitarbeitende direkt betreffen. Wer diese drei Einflussbereiche – interne, externe und persönliche Faktoren – systematisch betrachtet, legt den Grundstein für gezielte Maßnahmen und nachhaltige Verbesserungen.
Interne Faktoren
Viele Ursachen für hohe Fehlzeiten liegen direkt im Unternehmen selbst. Sie betreffen Strukturen, Kultur und Prozesse – und können mit gezielten Maßnahmen beeinflusst werden:
Schlechte Arbeitsbedingungen
Lärm, ungünstige Beleuchtung, ergonomisch ungeeignete Arbeitsplätze oder unzureichende Schutzausrüstung erhöhen das Risiko für Erkrankungen und Unfälle.
Ungünstiges Betriebsklima
Konflikte, fehlende Wertschätzung oder eine Kultur des Misstrauens wirken sich negativ auf Motivation und Anwesenheit aus.
Fehlende Führungskompetenz
Vorgesetzte ohne ausreichende Führungsqualitäten verstärken Probleme, statt sie zu lösen, und tragen so indirekt zu höheren Krankenständen bei.
Überlastung & Burnout
Dauerhaft hohe Arbeitslast ohne ausreichende Pausen führt zu körperlicher und psychischer Erschöpfung.
Geringe Motivation
Wenn Mitarbeitende keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen, sinkt ihre Bereitschaft, auch bei kleineren Beschwerden zu arbeiten.
Fehlende Gesundheitsförderung im Unternehmen
Ohne präventive Angebote wie Rückenschulen, Gesundheitstage oder Sportprogramme steigt das Risiko für Krankmeldungen. Aber bitte keine Geißkannemaßnahmen!
Unzureichendes Fehlzeitenmanagement
Fehlzeiten werden nicht systematisch ausgewertet, sodass sich wiederholende Muster und Kurzzeiterkrankungen unentdeckt bleiben.
Mangelnde Mitarbeiterbindung
Wer sich nicht mit dem Unternehmen identifiziert, meldet sich schneller krank.
Präsentismus
Mitarbeitende erscheinen trotz Krankheit zur Arbeit, was nicht nur ihre eigene Genesung verzögert, sondern oft auch Kollegen ansteckt.
Hohe Fluktuation und Einarbeitungsaufwand
Ständiger Personalwechsel führt zu Mehrbelastung für verbleibende Teams.
Unklare Rollenzuordnung und Verantwortungsbereiche
Wenn nicht klar ist, wer für welche Aufgaben zuständig ist, führt das zu Reibungsverlusten und Stress.
Mangelhafte Prozesse in Organisation und Administration
Fehlerhafte Abläufe erhöhen den Arbeitsdruck und die Fehleranfälligkeit.
Überlastete Führungskräfte
Wenn Führungskräfte selbst an ihrer Belastungsgrenze arbeiten, fehlt Zeit und Energie, um Mitarbeitende zu unterstützen.
Niemand trägt bei diesem Thema den Hut
Ohne klare Verantwortlichkeit für das Thema Krankenstand wird es nicht aktiv gesteuert.
Externe Faktoren
Nicht alle Ursachen für hohe Krankenstände liegen im Einflussbereich des Unternehmens. Viele sind von äußeren Umständen geprägt, die schwer oder gar nicht zu steuern sind – dennoch sollten sie in der Analyse berücksichtigt werden:
Saisonale Erkrankungen
Grippe, Erkältungswellen oder Pollenflug führen regelmäßig zu erhöhten Fehlzeiten in bestimmten Jahreszeiten.
Demografische Entwicklungen
Eine älter werdende Belegschaft hat naturgemäß mehr gesundheitliche Einschränkungen und längere Genesungszeiten.
Pandemien & Grippewellen
Globale oder regionale Krankheitsausbrüche können in kurzer Zeit große Teile der Belegschaft betreffen und über Wochen hinweg belasten
Gesetzliche Rahmenbedingungen & Krankschreibungsregeln
Änderungen bei Attestpflicht, telefonischer Krankschreibung oder AU-Bescheinigungen können das Fehlzeitenverhalten beeinflussen.
Regionale Arbeitsmarktsituation
In Gegenden mit hohem Fachkräftemangel sind Mitarbeitende oft selbstbewusster im Umgang mit Krankmeldungen.
Wirtschaftliche Unsicherheit
Wirtschaftliche Krisen oder drohender Stellenabbau können einerseits die Psyche belasten und krankheitsbedingte Ausfälle verstärken. Andererseits kann genau diese Angst um den Arbeitsplatz dazu führen, dass Mitarbeitende trotz Erkrankung zur Arbeit erscheinen (Präsentismus) – was die Genesung verzögert und weitere Ausfälle im Team verursachen kann.
Einfluss familiärer Belastungen
Pflege von Angehörigen oder Kinderbetreuung bei Krankheit führen zu kurzfristigen Abwesenheiten, auch wenn der Mitarbeitende selbst nicht erkrankt ist.
Gesundheitsversorgung & ärztliche Krankschreibungspraxis
Die Art, wie Ärztinnen und Ärzte Krankschreibungen handhaben, beeinflusst Häufigkeit und Dauer der Fehlzeiten.
Facharzttermine mit langen Wartezeiten
Ist ein Facharzttermin nur Wochen oder Monate später möglich, kann die betroffene Person während dieser Zeit krankgeschrieben sein.
Verkehrsanbindung & Pünktlichkeitsprobleme
Unzuverlässige Bahn- oder Busverbindungen können dazu führen, dass Mitarbeitende aus Angst vor Konsequenzen (z. B. Abmahnungen) lieber zu Hause bleiben.

Persönliche Faktoren
Neben internen und externen Ursachen spielen individuelle Gründe eine zentrale Rolle für den Krankenstand. Diese Faktoren sind oft vielschichtig und hängen eng mit der persönlichen Lebenssituation der Mitarbeitenden zusammen:
Absentismus
Wiederholtes, bewusstes Fernbleiben von der Arbeit ohne zwingenden medizinischen Grund.
Motivationale Abwesenheiten
Kurzzeitige Krankmeldungen entstehen, weil die Motivation fehlt, zur Arbeit zu kommen, auch wenn keine gravierende Erkrankung vorliegt.
Innere Kündigung
Mitarbeitende haben sich innerlich vom Unternehmen gelöst, arbeiten nur noch das Nötigste ab und sind häufiger krankgeschrieben.
Nebentätigkeiten
Nebenjobs können zu Überlastung oder Terminkonflikten führen und die Regeneration beeinträchtigen. Auch private Zusatzbelastungen wie saisonale Erntearbeit, Hausbau oder zeitintensive Hobbys können die Arbeitsfähigkeit einschränken.
Privatleben
Pflege von Angehörigen, Betreuung von Haustieren oder technische Probleme wie ein defektes Auto können kurzfristige Abwesenheiten verursachen.
Muster wie krank vor oder nach dem Urlaub
Auffällige Häufungen von Fehlzeiten vor oder nach Feiertagen, Brückentagen oder Urlauben können auf Unzufriedenheit, Erschöpfung, bewussten Missbrauch oder Absentismus hindeuten.
Unzufriedenheit mit der beruflichen Entwicklung
Fehlende Perspektiven oder ausbleibende Weiterentwicklung senken die Motivation und erhöhen die Krankheitsanfälligkeit.
Konflikte im Team oder mit Vorgesetzten
Zwischenmenschliche Spannungen wirken sich negativ auf die psychische und physische Gesundheit aus
Psychische Belastungen
Stress, Depressionen oder Angststörungen führen häufig zu wiederholten oder längeren Ausfällen.
Gesundheitsverhalten
Fehlende Vorsorgeuntersuchungen, ungesunde Ernährung oder Bewegungsmangel erhöhen das Krankheitsrisiko.
Fehlende Work-Life-Balance
Dauerhafte Überlastung, fehlende Erholungsphasen oder ständige Erreichbarkeit begünstigen Krankmeldungen.
Persönliche finanzielle Sorgen
Existenzängste oder hohe Verschuldung können zu psychosomatischen Beschwerden und längeren Ausfallzeiten führen.
Wirtschaftliche und organisatorische Folgen
Ein dauerhaft hoher Krankenstand ist mehr als nur eine Zahl in der Statistik – er beeinträchtigt die Gesundheit der Mitarbeitenden, schwächt die Produktivität und kann erhebliche finanzielle Belastungen für Unternehmen nach sich ziehen. Neben den offensichtlichen Kosten durch Lohnfortzahlung entstehen oft indirekte Schäden, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind: Produktionsausfälle, Überlastung der gesunden Mitarbeitenden, steigende Fehlerquoten oder verzögerte Liefertermine.
Selbst kleine Verbesserungen zeigen große Wirkung: Schon eine Reduzierung des Krankenstands um nur 1 % kann für ein mittelgroßes Unternehmen sechsstellige Einsparungen und hunderte zusätzliche Arbeitstage bedeuten.